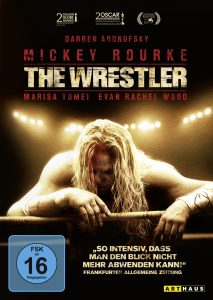Oliver Forst zum Kinobesuch
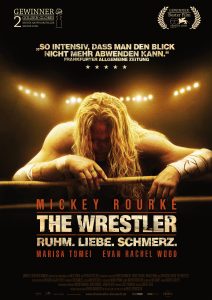 Zunächst einmal lasse man sich nicht vom Titel in die Irre leiten, denn Darren Aronofskys „The Wrestler“ ist keineswegs ein stupider Catcher- oder Actionfilm, sondern ein sensibles und liebevolles Meisterwerk über das Älterwerden, die Liebe und die Würde des Menschen. Es ist auch das phantastische Comeback einer der Ikonen der 80er Jahre: Mickey Rourke spielt den abgehalfterten Wrestler Randy Robinson mit einer solchen Inbrunst und Überzeugungskraft, dass es mit dem Teufel zugehen müsste, würde er für seine Rolle nicht mit dem Oscar belohnt werden. Den Goldenen Löwen durfte der Film ja bereits in Venedig einheimsen.
Zunächst einmal lasse man sich nicht vom Titel in die Irre leiten, denn Darren Aronofskys „The Wrestler“ ist keineswegs ein stupider Catcher- oder Actionfilm, sondern ein sensibles und liebevolles Meisterwerk über das Älterwerden, die Liebe und die Würde des Menschen. Es ist auch das phantastische Comeback einer der Ikonen der 80er Jahre: Mickey Rourke spielt den abgehalfterten Wrestler Randy Robinson mit einer solchen Inbrunst und Überzeugungskraft, dass es mit dem Teufel zugehen müsste, würde er für seine Rolle nicht mit dem Oscar belohnt werden. Den Goldenen Löwen durfte der Film ja bereits in Venedig einheimsen.
Randy „The Ram“ Robinsons große Zeiten liegen bereits lange zurück. Vorbei sind die Tage, an denen er in ganz Amerika gefeiert und als Idol verehrt wurde. Statt dessen bestreitet er mit billigen Schaukämpfen seinen Lebensunterhalt und versucht vergeblich mit Steroiden den Verfall seines Körpers zu bremsen. Doch es kommt, wie es kommen muss: Während eines Kampfes erleidet Randy einen Herzanfall und es gilt, das Leben neu zu ordnen. Er quittiert seinen Job, sucht Kontakt zu seiner Tochter Stephanie und nähert sich behutsam der Stripperin Cassidy an, die von ihren Kunden inzwischen ebenfalls als zu alt empfunden wird. Langsam findet er auch Gefallen an seiner neuen Arbeit als Fleischverkäufer in einem Supermarkt. In kleinen Schritten gewinnt er sogar das Vertrauen seiner so lange vernachlässigten Tochter zurück. Dennoch gestaltet sich sein Vorhaben auf ein normales und geregeltes Leben als schwierig. Seine Zuneigung Cassidy gegenüber wird nicht nach seinen Wünschen erwidert und nach einer durchzechten und von Drogen dominierten Nacht verschläft er ein Treffen mit Stephanie, die sich darauf enttäuscht endgültig von ihm abwendet. Einsam und ohne Perspektive trifft Randy eine folgenschwere Entscheidung.
Nach den kunstvoll geschnittenen „Pi“ und „Requiem For A Dream“ und dem etwas ambitionierten und komplexen „The Fountain“ überrascht Regisseur Darren Aronofsky nun mit „The Wrestler“, der auf jegliche kunstvolle Gestaltung verzichtet, sondern fast schon dokumentarisch und „dogmaesk“ erscheint. In grobkörnigen und mit Handkamera eingefangenen Bildern folgt Aronofsky völlig neutral und wertungsfrei seinen Protagonisten und lässt den Zuschauer an Freude, Leid, Hoffnung und Enttäuschung der Figuren teilhaben. Der Regisseur selbst bekennt, kein Fan des Wrestlingsports zu sein und dementsprechend funktioniert das Drama als Parabel auf ein Altern in Würde und die Schwierigkeiten, Liebgewonnenes fallen zu lassen und gar aufzugeben.
Sicherlich war es ein hohes Risiko, die Rolle des Randy mit Mickey Rourke zu besetzen, der nach einigen, ebenfalls lange zurück liegenden, Glanztaten eher durch Exzesse, misslungene Schönheitsoperationen oder Selbstüberschätzung beim Boxen aufgefallen war. Und tatsächlich belohnt Rourke das mutige Unterfangen mit der sicherlich besten Performance seines Lebens, das der Geschichte des Wrestlers nicht unähnlich sein dürfte. Selbst in Einstellungen, in denen er lediglich im Ansatz oder von hinten zu sehen ist, wird die ganze Tragik des Charakters physisch spürbar. Blickt man auf Aronofskys bisheriges Werk zurück, so wird dessen Drang, seine Figuren aufzubauen, nur um sie letztendlich wieder zu zerstören, augenfällig. Auch „The Wrestler“ macht da keine Ausnahme, doch scheint es so, als hätte der Regisseur durch die Wahl des Titels Ähnliches mit seinem Filmschaffen vor.
Falko Fröhner zum Disc-Release
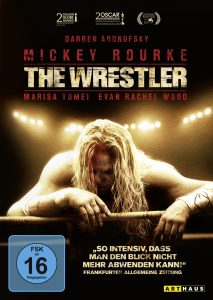 In The Wrestler gibt Darren Aronofsky Einblicke in die Lebenswirklichkeit eines ehemals erfolgreichen Kampfsportlers, der in Bezug auf seine weitere Lebensplanung an einem Wende- und Scheidepunkt angelangt ist.
In The Wrestler gibt Darren Aronofsky Einblicke in die Lebenswirklichkeit eines ehemals erfolgreichen Kampfsportlers, der in Bezug auf seine weitere Lebensplanung an einem Wende- und Scheidepunkt angelangt ist.
Der abgehalfterte frühere Profi- Wrestler Randy „The Ram“ Robinson träumt von einem großen Comeback- physisch ist er „gut in Form“ und in der Szene genießt er immer noch ein hohes Ansehen. Unerwartet bricht er jedoch nach einer Trainingseinheit zusammen und nachdem er im Krankenhaus operiert wurde, teilt ihm ein Arzt mit, er leide unter Herzproblemen und solle seine Karriere einstellen. Randy beherzigt jenen Rat und versucht, sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken- er verabredet sich mit der alleinstehenden Stripperin und Mutter Cassidy, die stets ein offenes Ohr für ihn hat und für die er Gefühle hegt, trifft nach Jahren seine Tochter, die ihm vorwirft, er habe sie ihr ganzes Leben lang im Stich gelassen, und nimmt einen Job in der Delikatessenabteilung eines Supermarktes an. Doch Randys Hoffnungen zerschlagen sich nach und nach, da Cassidy ein intimes Verhältnis zu ihm ablehnt, er seine Tochter wegen eines One-Night-Stands mit einer jungen Bewunderin versetzt und er sich in seinem Beruf von den Kunden und seinem Chef gedemütigt fühlt. Er beschließt, entgegen den Anweisungen seines Arztes, wieder in der Wrestling- Branche aktiv zu werden…

The Wrestler ist voller thematischer Bezüge zu anderen Werken Aronofskys, da auch in diesem Film ein Mensch, der einer Obsession verfällt, an der er sowohl geistig als auch körperlich zu Grunde geht, porträtiert wird: in Pi ist der geniale Mathematiker Max Cohen von der Idee besessen, die Welt durch Zahlen zu erklären und sogar zukünftige Entwicklungen durch Mathematik prophezeien zu können, in Requiem for a Dream gehen die Protagonisten an ihrer Drogensucht zu Grunde und in Black Swan scheitert die Protagonistin an ihrem Maßstab, die (tänzerische) Perfektion zu erreichen. Die Gemeinsamkeit jener Charaktere besteht in ihrem (scheiternden) Versuch, vor der Realität zu fliehen. Randy Robinson fügt sich nahtlos in die Reihe jener Anti- Helden ein, da seine Obsession der Wrestling- Sport ist, der ihm dazu „verhilft“, ihn von seinem menschlichen und emotionalen Versagen abzulenken. Genauso wie jene Kampf- Spektakel, deren Ablauf bereits vor dem Kampf abgesprochen ist, in den Zuschauern die Illusion erzeugen, sie sähen einen martialischen, grausamen Kampf, der „von Angesicht zu Angesicht“ ausgetragen würde, so gibt sich Randy der Vorstellung, über die er sein Selbstwertgefühl definiert, hin, er sei noch immer ein von allen Seiten bewunderter Sportler.
Die Parallelen zwischen Mickey Rourkes Biografie und dem fiktiven Lebenslauf Randys sind unverkennbar und das einzigartige Erscheinungsbild des Hauptdarstellers trägt erheblich zu der gelungenen Charakterzeichnung des Protagonisten bei.
Mit naturalistischer Präzision und ohne jegliche künstlerische Verklärung (im Gegensatz zu Requiem for a Dream) fängt die Handkamera jene Absteiger-Geschichte über das Scheitern einer „Sportler- Ikone“ ein, wodurch The Wrestler sehr authentisch und keinesfalls „kitschig“, d.h. allzu sehr an das Hollywood- Kino angebiedert, wirkt.
Trotz dieser bemerkenswerten Besonderheiten greift Drehbuchautor Robert D. Siegel auf Altbewährtes zurück, da The Wrestler dramaturgisch eher konventionell und streng durchkomponiert wirkt- dies ist per se nicht verwerflich, doch steht eben dies in Widerspruch zu Aronofskys Intention, einen Film zu schaffen, der einen (prägenden) Ausschnitt aus dem Leben des Protagonisten möglichst realitätsnah einfängt.
Dennoch ist The Wrestler ein sehenswertes Werk der jüngeren Filmgeschichte, das durch Mickey Rourkes Darbietung und die interessante Variation des für Aronofsky charakteristischen „Verfalls- Themas“ einen anhaltenden Eindruck im Zuschauer evoziert.
Wertung: 4 von 5
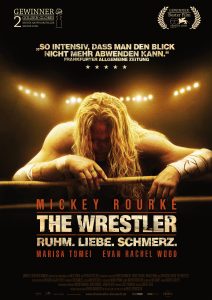 Zunächst einmal lasse man sich nicht vom Titel in die Irre leiten, denn Darren Aronofskys „The Wrestler“ ist keineswegs ein stupider Catcher- oder Actionfilm, sondern ein sensibles und liebevolles Meisterwerk über das Älterwerden, die Liebe und die Würde des Menschen. Es ist auch das phantastische Comeback einer der Ikonen der 80er Jahre: Mickey Rourke spielt den abgehalfterten Wrestler Randy Robinson mit einer solchen Inbrunst und Überzeugungskraft, dass es mit dem Teufel zugehen müsste, würde er für seine Rolle nicht mit dem Oscar belohnt werden. Den Goldenen Löwen durfte der Film ja bereits in Venedig einheimsen.
Zunächst einmal lasse man sich nicht vom Titel in die Irre leiten, denn Darren Aronofskys „The Wrestler“ ist keineswegs ein stupider Catcher- oder Actionfilm, sondern ein sensibles und liebevolles Meisterwerk über das Älterwerden, die Liebe und die Würde des Menschen. Es ist auch das phantastische Comeback einer der Ikonen der 80er Jahre: Mickey Rourke spielt den abgehalfterten Wrestler Randy Robinson mit einer solchen Inbrunst und Überzeugungskraft, dass es mit dem Teufel zugehen müsste, würde er für seine Rolle nicht mit dem Oscar belohnt werden. Den Goldenen Löwen durfte der Film ja bereits in Venedig einheimsen.