(„La chinoise“ directed by Jean-Luc Godard, 1967)
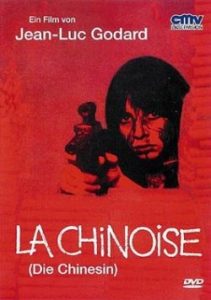 Neben Stanley Kubricks 2001: Odysee im Weltraum zählt Jean-Luc Godards La Chinoise – Die Chinesin innerhalb der Filmgeschichte als der wichtigste Film im Jahr 1968. Und das liegt im Gegensatz zu Kubricks metaphysischen Trip im All daran, dass kein anderer Film aus diesem historischen Jahr am besten das Lebensgefühl einer ganzen Generation auf den Punkt bringt. Das einzige was die beiden Filme eint ist, das Überschreiten der konventionellen Erzählstrukturen.
Neben Stanley Kubricks 2001: Odysee im Weltraum zählt Jean-Luc Godards La Chinoise – Die Chinesin innerhalb der Filmgeschichte als der wichtigste Film im Jahr 1968. Und das liegt im Gegensatz zu Kubricks metaphysischen Trip im All daran, dass kein anderer Film aus diesem historischen Jahr am besten das Lebensgefühl einer ganzen Generation auf den Punkt bringt. Das einzige was die beiden Filme eint ist, das Überschreiten der konventionellen Erzählstrukturen.
Inhaltlich sind die Filme dagegen so weit voneinander entfernt wie die Menschaffen bei Kubrick von der Raumfahrt. Und doch zeichnet Kubrick eine Linie vom Knochen zum Raumschiff (beides Werkzeuge). La Chinoise ist eine lose Adaption von – wenn nicht gar eine Parodie auf – Fjodor Dostojewskis Roman „Die Dämonen“ (auch „Böse Geister“, „Die Besessenen“, „Die Teufel“) von 1873. Darin skizziert der russische Schriftsteller das politische und gesellschaftliche Leben im vorrevolutionären Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, das von einem Zusammenstoß verschiedener ideologischer Geisteshaltungen – Nihilismus, Sozialismus, Liberalismus, Konservatismus – unter einer implodierenden zaristischen Herrschaft mit ihren traditionellen Werten und Normen geprägt war. Dostojewski personifiziert die Ideologien, indem er jeweils einen Protagonisten einer Ideologie zuteilt.
Auch bei Godard besteht eine Gruppe von fünf Personen – alles jungen Franzosen. Über die Ferien beziehen sie eine Wohnung, um die marxistischen Texte von Mao Tse-Tung zu studieren. Véronique (Anne Wiazemsky) ist eine Philosophiestudentin in Paris-Nanterre. Die Tochter aus gutem Hause will die erlernten Inhalte in praktische Taten umsetzen, indem sie innerhalb der Gruppe den Einsatz von Gewalt als Mittel zur Politisierung fordert, wohingegen der Naturwissenschaftler Henri (Michel Semeniako) eine friedliche Koexistenz in der Gesellschaft befürwortet. Der Maler Guillaume Meister (Jean-Pierre Léaud) definiert sich selbst gleichzeitig als Künstler und Politaktivisten, weshalb er an sozialistisches Theater nach dem Vorbild der chinesischen Kulturrevolution anstrebt. Yvonne (Juliet Berto) ist ein Provinzmädchen, das als Prostituierte gearbeitet hat und nun vor allem den Haushalt und bei satirischen Agitprop-Einlagen mitspielt. Schließlich ist da noch der suizidgefährdete Techniker Kirilov (Lex de Bruijin), der – wie in der Vorlage – aufgrund seiner philosophischen Irrungen Nihilist geworden ist.
La Chinoise ist ein polyphoner Film, der formell mit allen gängigen Erzähltraditionen bricht. Godard zitiert, montiert, collagiert und kommentiert aus den Bereichen Politik und Kultur, dass dem Zuschauer bisweilen schwindelig wird. Dabei schafft er eine Einheit von Form und Inhalt, beispielsweise zitiert der französische Filmemacher Comics während sich seine Filmsprache der Comicsprache bedient. Godard spielt den Grundfarben gelb, (vor allem aber) blau und rot undreflektiert darüber im Film. Überhaupt ist der Film auch gespickt mit einer bis dato ungekannten filmischen, zum Teil auch parodistischen, Selbstreflexion – so sieht man zum Beispiel einen Kameramann beim Filmen. Auf diese Weise überträgt Godard das Gefühl der vorübergehenden Mao-WG auf mit den Zuschauer, beziehungsweise kommuniziert mit ihnen.
Der Angriff auf die Bourgeoisie wird durch die roten Mao-Bücher, die stellvertretend für die gesamte marxistisch-leninistische Theorie stehen, untermauert. Im Film dienen die Mao-Bücher als Barrikade was darauf hindeutet, dass sich die Angreifer theoretisch hinter den maoistischen Texten verschanzen. Historisch gesehen ist Godards fiktionale Filmrevolution schlichtweg visionär, weil ein Jahr später, im Mai/Juni 1968 eine Gruppe revolutionärer Studenten aus in Nanterre in der Tat die Speerspitze der missglückten wirklichen Revolution waren.
Offenkundig imitiert Godard in La Chinoise das Brecht’sche Theater. Der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht ist bekannt für sein „episches“ beziehungsweise „dialektisches“ Theater, das den Zuschauer zum nüchternen Nachdenken veleiten soll, indem er das Theater absichtlich verfremdet und desillusioniert damit es als Schauspiel in Abgrenzung zur Realität erkennbar wird. Somit kommt er – und auch Godard – der Kritik an der Film- und Kulturindustrie der so genannten Frankfurter Schule (zum Beispiel Theodor W. Adorno, Walter Benjamin) entgegen, die kritisieren, dass der Film nur die Verlängerung der Realität sei.
Der einzig vergleichbare Film könnte Rainer Werner Fassbinders Die dritte Generation sein, in der er in Manier seines „Aktionstheaters“ die Orientierungslosigkeit der dritten Terrorgeneration beschreibt, wobei der deutsche Filmemacher bereits auf einen historischen Rahmen – RAF-Terror – zurückgreifen konnte, wohingegen Godard in seinen gut 90 Minuten noch keine historischen Bezugspunkte hatte.
(Anzeige)

