(„Journal d’un curé de campagne“ directed by Robert Bresson, 1951)
„To die is difficult – especially fort he proud.“
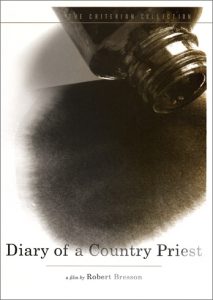 Die Einsamkeit und Isolation, die Obsessionen und Sehnsüchte des kleinen Landpfarrers waren, so erzählt man, die maßgebende Inspiration für den Entwurf des Charakters Travis Bickle aus Martin Scorseses „Taxi Driver“. Wie auch Scorseses urbanes Drama, so ist auch Robert Bressons karges, langsames Porträt des Unglücks ein Film über das Verlassen worden sein. Einige Personen in „Tagebuch eines Landpfarrers“ können damit umgehen, indem sie wenigstens eine gewisse Ordnung zu wahren versuchen, so wie die Comtesse, die vor Jahren ihren Sohn verloren hat und nun in ihrem großen Anwesen vor Selbstmitleid zerfließt und den Glauben an Gott längst verloren hat.
Die Einsamkeit und Isolation, die Obsessionen und Sehnsüchte des kleinen Landpfarrers waren, so erzählt man, die maßgebende Inspiration für den Entwurf des Charakters Travis Bickle aus Martin Scorseses „Taxi Driver“. Wie auch Scorseses urbanes Drama, so ist auch Robert Bressons karges, langsames Porträt des Unglücks ein Film über das Verlassen worden sein. Einige Personen in „Tagebuch eines Landpfarrers“ können damit umgehen, indem sie wenigstens eine gewisse Ordnung zu wahren versuchen, so wie die Comtesse, die vor Jahren ihren Sohn verloren hat und nun in ihrem großen Anwesen vor Selbstmitleid zerfließt und den Glauben an Gott längst verloren hat.
Da ist aber auch ihre Tochter, die sich von allen verlassen fühlt und auch aus diesem Grund einen tiefschürfenden Hass auf ihre Eltern entwickelt hat, der sie fliehen und den Wunsch nach einem Selbstmord in ihr reifen lässt. Auch der Doktor im Dorf, dessen Motto es ist, den Dingen des Lebens in die Augen zu sehen, wurde von fast allen Patienten und dem Glauben an Gott verlassen. Die einzige Lösung für ihn ist schließlich der Freitod. All diese Menschen leiden – wie auch ihr neuer Pfarrer im Dorf (Claude Laydu), dessen Namen wir nie erfahren. Jedoch wird nur selten das Leiden der Anderen so offen dargestellt wie die Pein und die Qualen des jungen Geistlichen, der in diesem Dorf nur auf Ablehnung stößt. Niemand will seine Hilfe, er erhält anonyme Briefe, dass er so schnell wie möglich dieses Gebiet wieder verlassen soll und es ist nicht ganz klar, woran er mehr leidet: an dieser Ablehnung, obwohl er nur Gutes will oder an den Schmerzen, die er in der Magengegend verspürt und die ihn dazu veranlassen, sich nur von trockenem Brot und Wein zu ernähren.
Dieser Zwang, den er sich selber auferlegt, ist wiederum ein gefundenes Fressen für seine Gemeinde, die ihn bald für einen Trinker hält, obwohl wir den kleinen Landpfarrer niemals betrunken sehen. Wir sehen ihn auch nie lächeln – nur ein einziges Mal, als er beginnt, die Freiheit zu spüren. Er wird auf einem Motorrad mitgenommen und spürt das Risiko in dieser kurzen Reise. Jeden Moment könnte er vom Sitz fallen und sich schwer verletzen. Spannung und Erleichterung – die einzig bekannte Quelle für menschliche Befriedigung.
Kurz zuvor hatte er ein Gespräch mit der Tochter der Comtesse. Die Tochter gesteht ihm, sie wolle das Leben leben und alles ausprobieren – die größten Risiken auf sich nehmen, um sich sicher sein zu können, das Leben auch wirklich erfahren zu haben, bevor sie sterbe. Als der Pfarrer auf dem Motorrad sitzt, muss er sich an diese Worte erinnert haben, die Kargheit und Tristesse seines Lebens abschüttelnd. Robert Bresson beschreibt diese Kargheit und Tristesse in nüchternen, unprätentiösen Bildern. Er setzt sein Werk nicht aus ausschweifenden Szenen zusammen, sondern aus kürzesten Beobachtungen und Begegnungen, welche der Pfarrer machen muss und somit in das Leben seiner Gemeindemitglieder einzudringen versucht, bevor er zur Tür gebeten wird.
Der Poet Philippe Ropat vergleicht in seinem Essay über Tagebuch eines Landpfarrers eben jenen Film mit dem später entstandenen Werk Pickpoket über einen Taschendieb, der zum Aufenthalt in einem Gefängnis verurteilt wird. Es gibt in beiden Filmen eine hohe Anzahl von Szenen, in welchen der Protagonist – in diesem Fall der kleine Landpfarrer – durch eine Tür in die Wohnungen der Gemeindemitglieder eindringt, gleichzeitig versuchend, Eintritt in ihr Seelenleben zu bekommen. Was folgt ist ein kurzer, intensiver Dialog, ehe der Landpfarrer frustriert diese Umgebung durch eine Tür verlässt. Schnitt. Er hat verloren, wieder einmal hat er den Anderen nicht von seiner Weltsicht überzeugen können und sein Leiden geht weiter. Vielleicht, doch dieser Gedanke kommt ihm nie, vielleicht ist der Grund für die Ablehnung, die er erfährt, die Stellung als Vertreter Gottes, als der er sich darzustellen versucht, in dem er sich konsequent von allen anderen abgrenzt, weil er nicht anders kann, in dem er standhaft behauptet: ‚A priest has no opinions.‘
Das Paradoxe an seiner schlichten Existenz in dieser Gemeinde, in der stets nur eine einzige Person den Gottesdienst zu besuchen scheint, ist, dass der einzige Mensch, den er von Gott und dem Glauben überzeugen kann, die Comtesse ist – und das in einem Moment, in welchem dem Pfarrer selbst Zweifel an der Gutmütigkeit Gottes aufkommen. Einen Abend zuvor sitzt er in seinem spärlich eingerichteten Apartment, als ihn wieder diese unerträglichen Schmerzen in seinem Magen befallen und davon überzeugt ist, dass Gott ihn bestrafe. ‚God is no torturer‘ muss er der Comtesse am nächsten Morgen einflößen und als er selber am wenigsten an das glaubt, was er sagt, gelingt ihm das Kunststück, dem einzigen Menschen in seiner feindseligen Gemeinde von der Existenz und Gutmütigkeit eines höheren Wesens zu überzeugen, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der Begriff der Gerechtigkeit ist ein Schlüssel in diesem so komplexen und doch so simplen Werk, nach dem immer wieder gefragt wird. Dieser Begriff der ‚justice‘ erfordert dabei keinerlei Interpretationen, um ihr Fehlen in dieser Gesellschaft zu bemerken. Die Comtesse stirbt wenig später, der Pfarrer selber leidet aufgrund seiner schlechten Gesundheit Höllenqualen und muss erkennen, wie der Baum seiner Arbeit nicht nur keine Früchte trägt, sondern zunehmend immer weiter verdorrt. Für seine absolute Hingabe muss er damit einen teuren Preis zahlen.
Robert Bressons Tagebuch eines Landpfarrers ist ein deprimierend realistisches, langsam fließendes und Geduld erforderndes, einzigartiges Meisterwerk voll bitterer Tragik, die von der absoluten Kargheit der Bilder herrührt. Das Scheitern der menschlichen Existenz als beeindruckend intensive Charakterstudie eines schwermütigen Priesters, der nur das Gute will, aber einsehen muss, dass mehr dazugehört, als nur ein guter Wille um sein Ziel erreichen zu können. Seine Hingabe zu Gott hat ihn von den Menschen nur immer weiter entfremdet, bis er schließlich an einem Punkt angekommen ist, an dem er selber erkennen muss, dass er nichts über die Menschen weiß – doch es ist längst zu spät, das zu ändern.
(Anzeige)






