(„Nebraska“ directed by Alexander Payne, 2013)
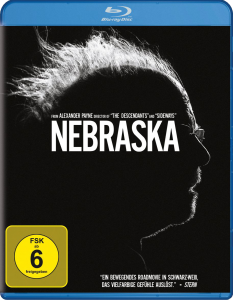 Wie heißt es so schön, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Wenn dem so wäre, David (Will Forte) hätte sicher einen Antrag auf Wechsel gestellt. Das nicht sonderlich geheime Oberhaupt der Grants ist Mutter Kate (June Squibb), die im Alter kein bisschen milder geworden ist, immer noch alles und jeden zur Schnecke macht, der ihr in den Weg kommt. Darunter hat dann vor allem Ehemann Woody (Bruce Dern) zu leiden. Der ist zwar ebenso grantig, von Natur aus aber schweigsam veranlagt, ein latenter Alkoholiker und durch seine beginnende Demenz auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig.
Wie heißt es so schön, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Wenn dem so wäre, David (Will Forte) hätte sicher einen Antrag auf Wechsel gestellt. Das nicht sonderlich geheime Oberhaupt der Grants ist Mutter Kate (June Squibb), die im Alter kein bisschen milder geworden ist, immer noch alles und jeden zur Schnecke macht, der ihr in den Weg kommt. Darunter hat dann vor allem Ehemann Woody (Bruce Dern) zu leiden. Der ist zwar ebenso grantig, von Natur aus aber schweigsam veranlagt, ein latenter Alkoholiker und durch seine beginnende Demenz auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig.
Da er aufgrund seiner Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft zudem schon immer ein leichtes Opfer für sein skrupelloses Umfeld war, kann er deshalb auch gar nicht verstehen, dass ein vermeintliches Gewinnerlos für eine Million Dollar in Wahrheit nicht mehr als ein Werbeprospekt ist. Alle Versuche, ihm diesen Traum auszureden, scheitern, immer wieder reißt er aus, um zu Fuß nach Nebraska zu kommen und das Geld einzuholen. Als es David irgendwann reicht, verspricht er seinem Vater, mit ihm die 900 Meilen lange Reise anzutreten. Unterwegs machen sie in Hawthorne, der alten Heimatstadt der Grants, Halt, wo im Kreise der Familie längst Vergangenes wieder auf den Tisch kommt.
Von 12 Years a Slave zu Gravity, von The Wolf of Wall Street zu American Hustle – auch wenn die Genrevielfalt beeindruckend war, eines hatten die Nominierungen für den Oscar als bester Film gemeinsam: Sie alle waren bis zum Rand prall mit Hollywoodstars gefüllt. Nur Nebraska wollte da nicht so recht reinpassen. Klar ist der Mann dahinter, Alexander Payne, kein Fremder beim Prozedere, zweimal schon war er schon im Rennen als bester Regisseur (Sideways, The Descendents). Und auch Bruce Dern könnte man während seiner 50-jährigen Karriere schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein. Doch im Vergleich zur großen Konkurrenz sind eher wie auch Filmsohn Will Forte (Saturday Night Live) dann doch eher Schauspieler aus der zweiten Reihe.
Größere Namen hätte sich Payne aber vermutlich auch nicht leisten können, ohne das Budget des Independentfilms in die Höhe zu treiben. Und einen besseren Job als die beiden hätten auch die Schwergewichte der Oscarkonkurrenz vermutlich auch gar nicht machen können. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Dern, der mit zerknautschtem Gesicht durch die Welt tappt, oft ohne so recht zu verstehen, was um ihn herum eigentlich passiert. Es wäre ein Leichtes gewesen, aus dem Stoff einen liebenswürdigen Trottel zu bauen. Aber Nebraska geht hier bewusst nicht den naheliegenden Weg. Bis zum Schluss ist der latente Alkoholiker nicht unbedingt der Sympathieträger des Films – das ist allein seinem gutmütigen, etwas willensschwachen Sohn David vorbehalten.
Er ist aber auch nicht der selbstbezogene Tyrann, den man anfangs vermutet, sondern ein Mann mit einfachen, recht symbolischen Sehnsüchten. Wenn dieser mit der Zeit immer häufiger hinter den Falten und dem unflätigen Verhalten hervortritt und Woody und David sich erstmals etwas annähern, wird nimmt das Porträt einer nicht ganz funktionierenden Familie auf einmal eine deutlich wärme Haltung ein, mit vielen zu Herzen gehenden, wunderschönen kleinen Momenten.
Diese Liebeserklärung an die Familie wird aber erst durch die Konfrontation mit der Vergangenheit möglich, und die ist nicht schön. „Sonst gibt es hier ja nichts anderes zu tun“, erwidert eine Jugendfreundin von Woody auf Davids Frage, ob sein Vater schon damals getrunken hat. Von der Außenwelt vergessen, von innen ausgeblutet ist Nebraska zugleich ein Abgesang auf die amerikanische Kleinstadt, wo der Jugend nur die Betäubung bleibt – oder die Flucht. Dieser nostalgische Blick in die Vergangenheit spielt sich auch in der Umsetzung wieder, erzählt wird der Film in ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Bildern, die ebenso anachronistisch und rau sind wie Hawthorne. Dazu passend komponierte Mark Orton einen Score, schlicht, wehmütig und bewegend.
Ganz der Tristesse wollte sich Drehbuchautor Bob Nelson bei seinem Filmdebüt aber nicht hingeben und setzte dem ernsten Grundgerüst eine Reihe komischer Momente entgegen, die vor allem die Bewohner von Hawthorne betrifft. Hier zeigt sich auch wieder Paynes Neigung zur Satire. Wenn Davids dümmlichen Cousins sich über dessen lange Fahrt lustig machen oder Verwandte und Freunde wie die Geier um den vermeintlichen Lottomillionär kreisen, kommen die Figuren nicht über den Karikaturcharakter hinaus. Doch das gelegentliche Lachen tut gut und das absurde Verhalten ist zudem der Anlass, den die Grants brauchen, um wieder zueinander zu finden. Bei aller Melancholie und gelebter Hässlichkeit findet die betont langsame Tragikomödie so am Ende doch noch versöhnliche Worte.
Nebraska ist seit 30. Mai auf DVD und Blu-ray erhältlich
(Anzeige)

