(„Alisa v strane chudes“ directed by Efrem Pruzhanskiy, 1981)
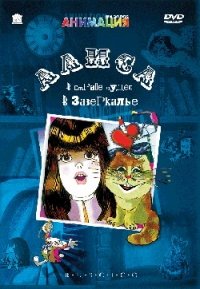 Hat dieses Kaninchen tatsächlich gerade gesprochen? Alice mag kaum ihren Ohren glauben, als sie – in eine Lektüre vertieft – sieht, wie das weiße Löffeltier an ihr vorbeirauscht. Das Mädchen, schon immer an ungewöhnlichen Geschichten interessiert und mit einer gesunden Portion Neugierde ausgestattet, lässt alles stehen und liegen und eilt hinterher. Doch damit beginnt das große Abenteuer erst noch, denn als sie dem Kaninchen in seinen Bau folgt, landet sie in einem seltsamen Land, das von körperlosen Katzen, verrückten Hutmachern und rauchenden Raupen bevölkert wird.
Hat dieses Kaninchen tatsächlich gerade gesprochen? Alice mag kaum ihren Ohren glauben, als sie – in eine Lektüre vertieft – sieht, wie das weiße Löffeltier an ihr vorbeirauscht. Das Mädchen, schon immer an ungewöhnlichen Geschichten interessiert und mit einer gesunden Portion Neugierde ausgestattet, lässt alles stehen und liegen und eilt hinterher. Doch damit beginnt das große Abenteuer erst noch, denn als sie dem Kaninchen in seinen Bau folgt, landet sie in einem seltsamen Land, das von körperlosen Katzen, verrückten Hutmachern und rauchenden Raupen bevölkert wird.
Eine Protagonistin, die ständig wächst oder schrumpft, Figuren, welche die Gestalt ändern, willkürlich erscheinen und verschwinden, zu Leben erwachte Karten, dazu der bekannte absurde Humor, der oft auf Sprachwitz und Doppeldeutigkeiten beruht – „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll verfilmen zu wollen, ist Geschenk und Alptraum zugleich. Vor allem die frühen Adaptionen hatten schon schwer damit zu kämpfen, die vielen sonderbaren Situationen in adäquate Bilder zu packen, zu rudimentär waren seinerzeit einfach noch die technischen Möglichkeiten.
Nicht wenige machten später aus der Not eine Tugend, drehten statt aufwendiger Realversionen einfach Zeichentrickfilme. Die erste und bekannteste ist dabei natürlich die aus dem Hause Disney von 1951, am produktivsten waren jedoch die 80er: Die japanische Langzeitserie von 1983 wurde selbst zu einem Klassiker, manche schwören auch auf den kürzeren australischen Beitrag aus dem Jahr 1988. Kaum bekannt hingegen ist eine sowjetische Adaption, die bereits 1981 entstanden ist – und das obwohl sie vielleicht die bemerkenswerteste der drei ist.
Das betrifft jedoch in erster Linie die visuelle Gestaltung. Die knallbunten Farben, wie wir sie aus den anderen Versionen kennen, sind hier verschwunden, haben deutlich dunkleren und etwas befremdlichen Alternativen Platz gemacht. Alice selbst hat blau-schwarz-weiße Haare, auch die Schatten sind bläulich, die Türen sind grün, manchmal sind bei den Hintergründen alle Farben auf einmal vertreten, dann wieder keine einzige. Ein bisschen sieht das so aus, als hätte ein Kind ein Bild zum Ausmalen gefunden und sich dieser Aufgabe angenommen, ohne Rücksicht darauf, ob das Ergebnis in einer Beziehung zur Realität steht oder nicht.
Das fühlt sich gleichzeitig falsch an und doch wieder passend, denn der surreale Ton des Buches – welcher oft zugunsten von familienfreundlichen Anmutungen geopfert wurde – wird so sehr schön eingefangen. Manche Szenen wiederum erinnern an die skurrilen Zwischensequenzen von Monty Python’s Flying Circus, was ebenfalls nicht das schlechteste Vorbild darstellt. Vervollständigt wird das schiefe Bild durch seitwärtsgehende Figuren, freischwebende Treppen und fehlende Perspektiven. Ob der ukrainische Regisseur Efrem Pruzhanskiy diesen Effekt tatsächlich in der Form beabsichtigt hatte oder nicht, sei mal dahingestellt, seine Fassung von „Alice im Wunderland“ ist aber die befremdlichste, furchteinflößendste der diversen Zeichentrickversionen.
Leider hält der Inhalt mit dem kurios-schlichten Äußeren nicht ganz mit. Originalgetreu ist der Film, aber ein Opfer seiner Kürze: Drei Teile à je 10 Minuten standen für die Adaption zur Verfügung. Und das ist trotz des episodenhaften Charakters des Buches und seines bescheidenen Umfangs am Ende doch nicht genug. Viele Szenen sind der Schere zum Opfer gefallen, was übrig blieb, wurde einfach aneinandergeheftet. „Alice im Wunderland“, das war immer auch die Geschichte eines Mädchens, das sich einer für sie fremden Welt wiederfindet und sich gegen sie behauptet. Pruzhanskiys Alice tut das nicht, sie ist eine getriebene, in mehr als einer Hinsicht farblose Person, von der man nie einen wirklichen Eindruck gewinnt. Doch auch wenn einen diese Kurzvariante zum Schluss etwas ratlos und unbefriedigt zurücklässt, faszinierend ist diese Version auf alle Fälle, ein lohnenswerter, zuweilen alptraumhafter Rausch der Sinne, der nicht nur für Sammler interessant ist.
(Anzeige)










