(„Chevalier“ directed by Athina Rachel Tsangari, 2015)
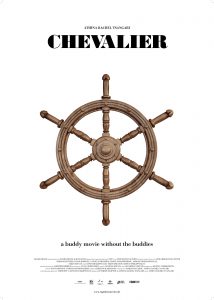
Eigentlich waren die sechs Männer mit der Privat-Luxusyacht zusammen aufs Meer gefahren, um dort zu fischen. Dieses Vorhaben rückt bei dem Doktor (Yorgos Kendros), Yorgos (Panos Koronis), Josef (Vangelis Mourikis), Dimitris (Makis Papadimitriou), Yannis (Yorgos Pirpassopoulos) und Christos (Sakis Rouvas) jedoch bald in den Hintergrund, als eines Abends beim Kartenspielen der Vorschlag aufkommt, sich in diversen anderen Disziplinen miteinander zu messen, um die Zeit bis zur Ankunft zu vertreiben. Um die Meeresbewohner kümmert sich anschließend keiner mehr, stattdessen geht die ganze Energie drauf, sich immer neue Aufgaben auszudenken, welche die Gruppe lösen muss.
„Ich bin der beste!“ „Nein, ich!“ „Nein, ich!“
Solche kleinen Selbstbehauptungswettkämpfe kennen wir alle aus dem Kindergarten oder dem Schulhof. Im Erwachsenenalter haben wir diese kindischen Auseinandersetzungen aber längst hinter uns gelassen und widmen uns nun wichtigeren Dingen. Sollte man meinen. Tatsächlich gibt es diese Wettkämpfe auch dann noch, wie uns die griechische Regisseurin und Ko-Autorin Athina Rachel Tsangari in ihrem dritten Film Chevalier vor Augen führt. Wir wollen auch dann immer noch die besten sein, geradezu zwanghaft suchen wir nach Anerkennung durch andere. Nur sind es da andere Disziplinen, in denen wir uns messen, meist solche, die mit Status und finanziellem Erfolg einhergehen.
Implizit spielen die auch hier immer mit ein, wenn sich die sechs gestandenen Männer um einen kleinen Ring balgen, der den Besitzer an die Spitze der yachtinternen Hierarchie setzt. In feinen Beobachtungen zeigt uns Tsangari anhand der sechs aus verschiedenen Schichten stammenden und auch im Alter unterschiedlichen Protagonisten eine Rangelei, die gleichzeitig ein Abbild der sozialen Strukturen ist. Weniger fein wird es, wenn im Laufe des Wettkampfes das nicht mehr ausreicht, die Männer nach immer absurderen Disziplinen suchen, um sich vor den anderen zu beweisen – das reicht von einer Schlafposition übers Silberputzen bis zum obligatorischen Schwanzvergleich. Kultur und Barbarei, das kann auch durchaus mal Hand in Hand gehen.
Subtil ist das nicht, die Absicht hinter Chevalier ist zu jeder Zeit klar ersichtlich: Der Gesellschaft und vor allem dem männlichen Teil den Spiegel vorhalten und die Lächerlichkeit eines ständigen Konkurrenzverhaltens aufzeigen, der sich längst verselbständigt hat. Das ist Tsangari prinzipiell gelungen, als Film am Ende jedoch weniger interessant, als es die Idee ist. Dass ein solcher Wettkampf nicht unbedingt viel inhaltliche Variation zulässt, liegt auf der Hand, tatsächlich ist die satirisch gefärbte Komödie auf Dauer auch eher eintönig. Vor allem aber ist sie weniger komisch, als man erwarten sollte. Sicher muss es nicht immer Schenkelklopferhumor sein, den bekommen wir aus den USA, teilweise auch aus Deutschland schon mehr als genug. In Chevalier mangelt es aber an tatsächlich witzigen und bösartigen Stellen. Nur hin und wieder, wenn ein neuer Disziplinvorschlag besonders absurd wird oder die feinen Herren plötzlich voller Tatendrang niedere Hausarbeiten machen, die sie natürlich ebenfalls alle beherrschen, setzt der Film Ausrufezeichen. Ansonsten schippert er aber etwas ereignislos auf seinen Zielhafen zu.
(Anzeige)







