(„Ten Billion“ directed by Peter Webber, 2015)
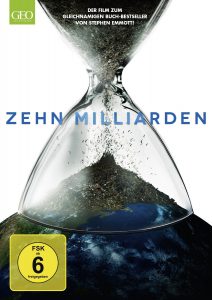
Zehn Milliarden ist eine dieser Stichzahlen, wenn es darum geht, die aktuelle Entwicklung der Menschheit zu beschreiben. Eine schön plakative Zahl, hinter der ein nicht so schönes Schicksal lauert. Beeindruckend ist die Entwicklung auf jeden Fall: Während in den 60ern die Weltbevölkerung noch bei 3 Milliarden lag, sind es heute 7,5 Milliarden, um 2050 soll dann die Schwelle zur 10 fällig sein. Und gehört haben dürften das die meisten auch schon. Gehört und ignoriert. Zum einen, weil 2050 noch so weit weg ist und wir in Deutschland ohnehin immer zu hören bekommen, dass bei uns zu wenig Kinder geboren werden – das lässt sich erst einmal nicht in Einklang bringen. Und selbst wenn: Was wäre so schlimm daran, wenn es ein paar Leute mehr wären?
Alles, so die Antwort für Stephen Emmot. Der ist eigentlich wissenschaftlicher Leiter eines Microsoft-Labors und im Bereich Wissenschaftliches Rechnen daheim. Und eines Tages gab er sich den Spaß, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich zehn Milliarden konkret für uns bedeutet, nur um festzustellen, dass das alles andere als ein Spaß ist. Heraus kam zuerst ein Buch, dann ein Theaterstück, jetzt wird das Thema im Rahmen eines Films verarbeitet. Sowohl der berufliche Hintergrund als auch der des Theaters ist dabei in Zehn Milliarden stets zu spüren, wenn Emmot den ganzen Film über auf einer Bühne steht, unaufgeregt Zahlen und Fakten herunterrattert und dabei damit kokettiert, normalerweise nicht vor Publikum aufzutreten.
Aber hinter der nüchternen Fassade zeigt der Engländer durchaus seinen Hang zur Dramatik. Nicht kleckern, sondern klotzen heißt es hier, Emmot lässt keine Gelegenheit aus, ein Worst-Case-Szenario nach dem anderen auszumalen. Hoffnung gibt es keine, nicht einmal durch technologischen Fortschritt – ausgerechnet die Atomtechnologie einmal ausgenommen, die derzeit aber politisch keine Befürworter mehr findet. „I think we are fucked“, gibt er unverblümt zu. Das war es auch, was ihm von Anfang an viel Kritik eingebracht hat: der sehr plakative Umgang mit dem Thema, der nur wenig Raum für Zwischentöne ließ, und eine recht freie Interpretation der Zahlen, die hier zu einem bloßen Mittel zum Zweck wurden. Und der Zweck lautete eine schockierend düstere Zukunftsvision aufzuzeigen.
Zumindest das ist ihm und seinem Regisseur Peter Webber auch prima gelungen: Malträtiert von aufwendigen und alarmierenden Bildern ist man als Zuschauer hier nach gut 80 Minuten so niedergeschlagen, dass man am liebsten die Welt da draußen gleich ganz vergessen mag. Ob diese fatalistische Vorschlaghammermethode nun pädagogisch wertvoll ist, darüber mag man sich streiten, der Faktor „Was kann ich tun?“ kommt über ein bloßes „konsumier nicht so viel“ kaum hinaus. Auch andere Aspekte, etwa das Ungleichgewicht zwischen arm und reich oder der unbedingte Wille zum Wachstum des Kapitalismus werden kaum wirklich angesprochen. Aber vielleicht spielt das auch schon keine Rolle mehr, wenn das Grundproblem ist, dass die Erde einfach nicht genügend Ressourcen für zehn Milliarden Menschen bietet. Egal wie sie verteilt sein mögen. Das lädt ein, den eigenen Umgang mit diesen zu überdenken, zumindest beim eigenen Leben anzufangen und darauf zu hoffen, dass möglichst viele andere es einem gleichtun werden.
(Anzeige)







