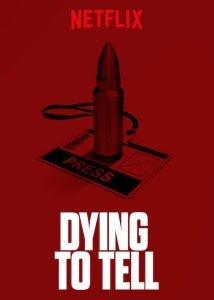
Ruhm und Ehre? Das bekommt man als Journalist heutzutage eher selten. Was früher ein hoch angesehener Beruf war, für den man auf Partys schon mal bewundernde Blicke erhielt, steht heute von allen Seiten aus unter Beschuss. Nicht nur, dass diese Arbeit oft nicht mehr lohnt, seitdem die Digitalisierung das bisherige Umfeld fast völlig verändert hat – klassische News und Berichte sind immer weniger gefragt, durch das Internet kann heute jeder Journalist spielen. Als Vertreter der „Lügenpresse“ steht man, auch dank politischer Hetze, unter Generalverdacht, nur ein Anhängsel der Mächtigen da oben zu sein. Wer auch immer das sein soll. Ganz zu schweigen von einer wachsenden Zahl an Ländern, in denen schon die Ausübung des Berufs eine Lebensgefahr darstellt.
Die Netflix-Dokumentation Dying to Tell erzählt von solchen Ländern, erzählt von Männern und Frauen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um den Menschen daheim von den Geschehnissen an der Kriegsfront zu erzählen. Hernán Zin war selbst einer von ihnen. In über 50 Ländern war der Argentinier unterwegs, um über Armut und Kriege zu berichten. Auch er hat zu spüren bekommen, was es heißt, im Schussfeld zu stehen und Ziel eines Angriff zu werden – sei es beabsichtigt oder nicht.
Wenn Beobachter Opfer werden
Zin berichtet dabei auch von eigenen Erfahrungen, überlässt größtenteils aber anderen das Wort. Er holt diejenigen vor die Kamera, die sonst oft eher dahinter stehen. Menschen, die dafür sorgen, dass wir zumindest spärliche Einblicke in das erhalten, was da draußen vor sich geht. Die von den Gräueltaten zeugen, von der Gewalt und dem Elend. Sie stammen dabei aus allen Ecken und Enden der Welt, auch ihre Einsatzorte sind vielfältig: Dying to Tell versammelt eine beeindruckende Anzahl an Beispielen, die sich für die Wahrheit einsetzen. Die teilweise ihrem Eifer aber auch zum Opfer fielen.
Thema ist dabei nicht nur die Arbeit an sich, auch das Persönliche wird immer wieder angesprochen. Welche Auswirkungen hat es beispielsweise auf das Privatleben, wenn man unentwegt in gefährlichen Gegenden unterwegs ist, die Angehörigen bei der Verabschiedung nie wissen, ob sie dich noch einmal wiedersehen? Wenn in dem Film eine Frau den Sarg ihres Mannes in Empfang nehmen muss, dann geht einem das als Zuschauer dann auch durchaus durch Mark und Bein.
Zu viel des Schlechten
Auf Dauer ist dieser Effekt jedoch nicht aufrechtzuerhalten. Ausgerechnet die Stärke von Dying to Tell – die hohe Anzahl an Fällen und Interviewpartnern – wird irgendwann zur Schwäche. Denn so wichtig der Beruf der Porträtierten sein mag, so ehrenvoll das Anliegen, irgendwann verschwimmen die Grenzen, es fällt zunehmend schwer, die einzelnen Reporter noch wirklich voneinander zu unterscheiden und als Individuen wahrzunehmen. Das Anliegen des Films, den Menschen ein Gesicht zu geben, die sonst nur Vermittler sind, es geht nicht wirklich auf. Dafür sind sich die Geschichten auch einfach zu ähnlich.
Über die Kriege an sich schweigt sich Zin ohnehin aus. Warum es sie gibt, wer gegen wen kämpft, das wird nicht thematisiert. Für die Arbeit der Reporter ist das natürlich auch nicht relevant. Es trägt aber zusammen mit der wenig variierten Anhäufung sprechender Köpfe dazu bei, dass die Einzelschicksale, so tragisch sie teilweise auch sein mögen, mit der Zeit austauschbar werden, man innerlich stärker abstumpft, als es bei dem Thema der Fall sein sollte. Als Denkmal für mutige Menschen und einen Beruf, der mehr Anerkennung verdient hätte, taugt Dying to Tell jedoch auf alle Fälle. Eine Erinnerung daran, wie die Bilder eigentlich entstehen, die wir daheim gemütlich auf der Couch konsumieren.
(Anzeige)

