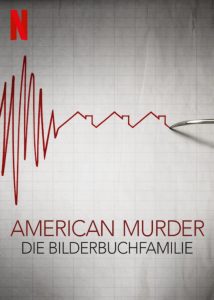
Im stetig wachsenden True Crime Doku Segment von Netflix gibt es zwei Richtungen, die gerne unter demselben Label verkauft werden, dabei aber doch sehr unterschiedlich sind. Die eine Richtung sind die oft eher nüchternen Vertreter, bei denen die Frage im Mittelpunkt steht: Wer war der Mörder? Dazu gehört beispielsweise der deutsche Beitrag Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit, welcher verschiedene Theorien zu dem Mord an dem Politiker und Manager Detlev Rohwedder zusammentrug und mit einem Zeitporträt verband. Die andere Richtung setzt auf maximale Gefühle, wie etwa das kaum zu ertragende Der Fall Gabriel Fernandez, welches die grausame Misshandlung eines kleinen Jungen festhielt, der daran letztendlich auch starb.
Ein klarer, grausamer Fall
American Murder: Die Bilderbuchfamilie ist ebenfalls ein Fall dieser zweiten Richtung. Viel zu spekulieren oder zu rätseln gibt es hier nicht. Wenn am Anfang der Doku noch von einem unerklärlichen Verschwinden einer Frau und ihrer beiden kleinen Töchter die Rede ist, weiß man bereits durch den Titel, dass es kein gutes Ende gibt, geben kann. Auch die Suche nach einem Täter dauert nicht lange, da nur der Ehemann als potenzieller Verdächtiger in Frage kommt. Eine Zeit lang wird noch ein bisschen versucht, die Antwort hinauszuzögern, auch indem der Film ständig in der Chronologie umherspringt. Mal sind wir auf der Zeitachse nach dem Verbrechen, dann springen wir ein paar Monate zurück, nur um dann doch noch mal nach vorn zu drehen. Es ändert jedoch nicht viel an der Geschichte.
Dafür geht der Fall, wenn er dann mal mit offenen Karten spielt, schon nahe. Gerade die zahlreichen Familienvideos aus glücklicheren Tagen sind in dem Bewusstsein, dass es nie wieder solche Momente gibt, harter Stoff. Sie sind aber auch deshalb eine Zumutung, weil American Murder: Die Bilderbuchfamilie zwar verrät, was passiert ist, aber keine wirkliche Erklärung dafür liefern kann. Im Anschluss werden lediglich ein paar Zahlen in den Raum geworfen, was dem Schicksal aber kaum gerecht wird. Am Ende bleiben nur Wut und Schmerzen, dazu etwas Hilflosigkeit. Und natürlich das Unverständnis, warum etwas Derartiges hat passieren müssen.
Tragische Oberflächlichkeit
Man kann sich jedoch darüber streiten, ob dieser emotionale Aspekt allein tatsächlich schon eine Daseinsberechtigung für den Dokumentarfilm bedeutet. Sonderlich in die Tiefe geht American Murder: Die Bilderbuchfamilie dabei nämlich nicht. Weder gelingt es Regisseurin Jenny Popplewell, den gesellschaftlichen Kontext tatsächlich mit den Ereignissen zu verknüpfen. Ist das hier ein Einzelschicksal oder das Beispiel eines ganz generellen Problems? Woher kommt diese Statistik? Und was kann man dagegen tun, dass ein solches Verbrechen geschieht? Es fehlt aber auch die psychologische Komponente, welche das Ganze irgendwie greifbar machen könnte.
Ein Grund dafür ist, dass Popplewell auf Interviews völlig verzichtet, weder mit Betroffenen, noch mit Experten, die etwas zu dem Fall sagen könnten. Stattdessen ist der Film ein Zusammenschnitt aus Verhöraufnahmen, Videos aus dem Familienarchiv und Social-Media-Beiträgen oder Nachrichten, die im Vorfeld geschrieben wurden. Dadurch wirkt American Murder: Die Bilderbuchfamilie immer wie eine Geschichte aus zweiter Hand. Etwas, das man von anderen gehört hat und schockiert weiter erzählt, ohne Genaueres zu wissen. Aufgrund des hohen Tragikfaktors wird die Dokumentation die Fans eben solcher emotionalen True Crime Dokus ansprechen und aufrütteln. Der Film verlässt sich aber zu sehr darauf.
(Anzeige)






