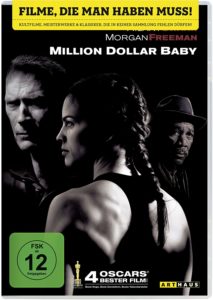
Für Frankie Dunn (Clint Eastwood) gab es immer nur das Boxen, seit vielen Jahren schon trainiert er den Sport. Den großen Durchbruch hat er dabei nie geschafft, auch weil ihm im Zweifel der Schutz seiner Leute wichtiger war als der schnelle Ruhm. Inzwischen ist er alt, sein heruntergekommenes Studio hat schon deutlich bessere Tage gesehen. Dennoch halten ihm einige die Treue, allen voran Scrap (Morgan Freeman), der selbst einmal ambitionierter Boxer war, bevor er schwer verletzt wurde. Da taucht eines Tages Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) bei ihnen auf. Sie ist eigentlich Kellnerin, hat auch kaum Erfahrungen beim Boxen und ist mit Anfang 30 schon zu alt, um noch wirklich damit anzufangen. Dafür hat sie einen starken Willen und ist bereit, für ihren Traum aufs Äußerste zu gehen …
Der Traum gebrochener Helden
Als Regisseur hat Clint Eastwood schon eine gewisse Vorliebe für Heldengeschichten, selbst wenn diese schon mal gewisse Ambivalenzen beinhalten können. Sully über den Piloten, der so spektakulär im Hudson River notlandete, erzählt wie jemand an Ruhm zu zerbrechen droht. Bei Der Fall Richard Jewell, ein weiteres auf einer wahren Geschichte basierendes Drama, zeigt einen Mann, der ebenfalls viele Menschenleben rettet, aufgrund seiner fragwürdigen Vorgeschichte anschließend durch die Hölle geht. Licht und Schatten liegen bei den Filmen des einst als Westernheld gestarteten Filmemachers oft nah beisammen, sodass man im Vorfeld gar nicht so genau sagen kann, woran man letztendlich ist.
Bei Million Dollar Baby war das ganz ähnlich. Zunächst überrascht der Film damit, dass mit Maggie eigentlich eine Frau die Hauptfigur ist. Ansonsten sind die Regiearbeiten von Eastwood meist reine Männerclubs, allenfalls bei den Nebenfiguren lässt sich hin und wieder mal eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts blicken. Wobei auch dieses Drama sich nicht ganz dazu durchringen kann, sie in den Mittelpunkt zu stellen. So läuft es am Ende darauf hinaus, dass der Film letztendlich doch den von Eastwood gespielten Frankie am liebsten hat und ihn porträtieren möchte. Maggie ist dabei nur eine Episode, die dessen Leben prägt. Erzählt wird die Geschichte zudem von Scrap, damit die männliche Deutungshoheit bewahrt bleibt.
Gut gespielte Klischees
An der einen oder anderen Stelle darf man das immerhin für einen Oscar nominierte Drehbuch von Paul Haggis (James Bond 007: Casino Royale) daher schon in Frage stellen. Gerade das Ende wurde sehr kontrovers aufgenommen. Dafür scheute der kanadische Autor nicht davor zurück, auch die richtig hässlichen oder zumindest schwierigen Seiten der Figuren zu zeigen. Selbst zwischen Frankie und Scrap, die seit Menschengedenken schon miteinander befreundet sind, kommt es zu diversen Reibungen. Die sind zum Teil auf tatsächliche Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen, zum Teil darauf, dass Kommunikation nicht unbedingt ihre große Stärke ist. Da wurden Gefühle wieder mal tief unter der Oberfläche eingebuddelt, in der Hoffnung, dass sie dort niemand findet.
Sehenswert ist Million Dollar Baby deshalb zum einen wegen der schauspielerischen Leistungen des Trios, das dieses versteckte Innenleben behutsam nach außen kehrt. Auch wenn die Figur des Boxtrainers, der unter seiner harten Schale ein weiches Herz versteckt, sicherlich nicht die originellste Kreation der Filmgeschichte ist, trägt der knorrige Charme Eastwoods maßgeblich dazu bei, dass man doch gerne Zeit mit ihr verbringt. Vor allem aber Hilary Swank beeindruckt als Frau, die sich durchs Leben schlägt und als Boxerin Karriere macht, obwohl sie weder die Erfahrung, noch die Statur mitbringt und selbst das Talent eher fraglich ist. Sie ist der typische Underdog, der sich von Wahrscheinlichkeiten nicht abhalten lässt und trotz aller Vorbehalte weitermacht. So jemanden sieht man immer gern, das geht gut zu Herzen.
Von Schattenseiten und Schmerzen
Doch Million Dollar Baby ist kein Wohlfühldrama über den Triumph des Nobodys, nicht die weibliche Antwort auf Rocky. Stattdessen zeigt Eastwood die Schattenseiten des Amerikanischen Traums, der eben nicht nur Gewinner hervorbringt. Im Gegenteil: Was hier hoffnungsvoll beginnt, wandelt sich in einen sehr düsteren Film, der nicht nur die Figuren im Ring, sondern auch die Menschen vor dem Bildschirm verletzt zurücklässt. Der Boxsport wird hier nicht glorifiziert, sondern in all seiner Brutalität gezeigt. Dabei lässt der Film offen, ob die tragischen Ereignisse nun das Ergebnis eines fehl geleiteten Traums waren oder ob sich der Kampf trotz allem gelohnt hat. Ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und nichts zu erreichen, oder beim Versuch der Selbstverwirklichung alles zu verlieren? Die Antwort muss das Publikum geben, das verwöhnt durch die vielen „Du kannst alles schaffen“-Aufbaufilme nun vor den Scherben steht und nicht so recht weiß, was mit diesen anzufangen ist.
OT: „Million Dollar Baby“
Land: USA
Jahr: 2004
Regie: Clint Eastwood
Drehbuch: Paul Haggis
Vorlage: F.X. Toole
Musik: Clint Eastwood
Kamera: Tom Stern
Besetzung: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Margo Martindale
| Preis | Jahr | Kategorie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Academy Awards | 2005 | Bester Film | Sieg | |
| Beste Regie | Clint Eastwood | Sieg | ||
| Bestes adaptiertes Drehbuch | Paul Haggis | Nominierung | ||
| Bester Hauptdarsteller | Clint Eastwood | Nominierung | ||
| Beste Hauptdarstellerin | Hilary Swank | Sieg | ||
| Bester Nebendarsteller | Morgan Freeman | Sieg | ||
| Bester Schnitt | Joel Cox | Nominierung | ||
| César | 2006 | Bester fremdsprachiger Film | Sieg | |
| David di Donatello Awards | 2005 | Bester fremdsprachiger Film | Sieg | |
| Golden Globes | 2005 | Bester Film – Drama | Nominierung | |
| Beste Regie | Clint Eastwood | Sieg | ||
| Beste Hauptdarstellerin | Hilary Swank | Sieg | ||
| Bester Nebendarsteller | Morgan Freeman | Nominierung | ||
| Beste Musik | Clint Eastwood | Nominierung |
Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.
(Anzeige)








