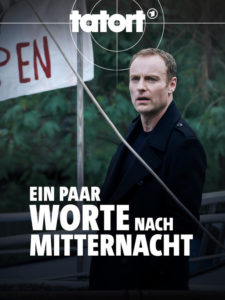
Es hätte ein ganz großes Fest werden sollen, schließlich wird Klaus Keller (Rolf Becker) 90 Jahre alt. Doch am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden, von einem Unbekannten erschossen, um sein Hals ein Schild mit der Aufschrift „Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen“. Als Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) die Ermittlungen aufnehmen, konzentrieren sie sich auf das familiäre Umfeld: Sohn Michael (Stefan Kurt), der inzwischen das Familienunternehmen übernommen hat, dessen Frau Maja (Marie-Lou Sellem) sowie der gemeinsame Sohn Moritz (Leonard Scheicher), aber auch Neffe Fredo (Jörg Schüttauf), der als Politiker in der Neuern Rechten aktiv ist. Doch wer könnte ein Motiv gehabt haben? Und was hat es mit dem ominösen Geständnis auf sich, welches Klaus noch kurz vor seinem Tod machen wollte?
Die Begegnung mit der Vergangenheit
Die Vergangenheit spielt beim Tatort natürlich immer eine große Rolle. Schließlich geht es dort fast immer, wie es bei Krimi nun einmal üblich ist, darum, ein Verbrechen aufzuklären. Dafür müssen es die Ermittler und Ermittlerinnen schaffen, die Vergangenheit zu rekonstruieren, den Tathergang zu verstehen, das Motiv zu erkennen – und natürlich, wer das Verbrechen überhaupt begangen hat. Aber es gibt doch immer mal wieder Teile, bei denen es weniger um die unmittelbare Vergangenheit geht, sondern darum, wie lang zurückliegende Ereignisse die Gegenwart beeinflussen. Der RAF-Verschwörungsthriller Der rote Schatten ist ein Beispiel. Ein paar Worte nach Mitternacht, welches sich auf das immer wieder gern verwendete Thema der Nazi-Verbrechen bezieht, ein anderes.
Wobei Drehbuchautor Christoph Darnstädt (Tschiller: Off Duty, Das Experiment) diese Geschichte nicht als reines Moralstück aufzieht, das von der universellen Schuld des deutschen Volkes spricht. Vielmehr ist Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht dabei ausschließlich auf eine Familie konzentriert und erzählt von den Verwerfungen, Konflikten und dunklen Geheimnissen, die dort vorherrschen. Der 1139. Film der ARD-Krimireihe ist deshalb im Kern eigentlich ein Familiendrama. Da liegt so vieles im Argen, gibt es unausgesprochene Vorwürfe, welche den Alltag vergiftet haben. Hier kann fast niemand mehr miteinander reden, weil sich keiner den offensichtlichen Abgründen stellen mag. Und ausgerechnet derjenige, der das endlich wollte – Opa Klaus – ist im Anschluss tot.
Fragen zu Schuld und Vergebung
Damit verbunden sind natürlich grundlegendere Fragen zum Thema Schuld und Vergebung. Ist es möglich, eine Vergangenheit hinter sich zu lassen? Kann man ein anderer Mensch werden? Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht ist an der Stelle weit entfernt von dem Versöhnungskitsch, den solche Geschichten gerne mal aufwarten. Der Film versucht zudem, sich nuanciert damit auseinanderzusetzen, indem er zu eindeutige Schwarzweiß-Zeichnungen vermeidet. Stattdessen gibt es hier lauter Leute, die sehr menschlich sind, obwohl sie so kaputt sind. Oder vielleicht gerade weil sie so kaputt sind: Regisseurin Lena Knauss (Tagundnachtgleiche) zeigt auf, wie fragil das Konstrukt Familie sein kann. Und auch wenn die Kellers sicherlich eine ungewöhnlichere Geschichte haben als die meisten, so findet sich hier doch genug, bei dem man als Zuschauer und Zuschauerin andocken kann.
Wer sich nur für den Kriminalfall interessiert, kommt bei Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht ebenfalls auf seine Kosten. Hier darf man trotz der an und für sich überschaubaren Zahl an Verdächtigen lange rätseln, was denn nun wirklich geschehen ist. Die Antwort ist einigermaßen überraschend und von derselben Tragik geprägt, wie es der Rest der Geschichte ist. Anders als bei vielen Krimis, wo man nach der Auflösung mit einem Gefühl der Befriedigung wieder ins wahre Leben entlassen wird, da ist das hier deutlich bitterer. Man bekommt nicht die einfache Antwort, nach der alles wieder schön gerade gerückt ist. Stattdessen wird einem erst dann bewusst, wie viel nicht stimmt und vielleicht auch gar nicht mehr stimmen kann.
(Anzeige)






